Was ist das Lieferkettengesetz?
Ob Kinderarbeit auf Kakaoplantagen oder illegale Abholzung für Rohstoffe – viele Produkte entstehen unter Bedingungen, die kaum sichtbar, aber problematisch sind. Das Lieferkettengesetz, das seit 1. Januar 2023 in Deutschland gilt, ändert genau das: Es verpflichtet große Unternehmen, Missstände entlang ihrer Lieferketten zu identifizieren, zu verhindern und öffentlich zu machen – und damit Menschenrechte sowie Umweltstandards weltweit zu stärken.
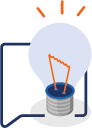
Wussten Sie?
Das Lieferkettengesetz heißt eigentlich Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und wird daher häufig mit LkSG abgekürzt.
Welche Unternehmen sind betroffen?
Das Lieferkettengesetz gilt abgestuft nach Unternehmensgröße:
| Jahr | Geltungsbereich |
|---|---|
| seit 2023 | Unternehmen mit mind. 3.000 Mitarbeitenden in Deutschland |
| seit 2024 | Unternehmen mit mind. 1.000 Mitarbeitenden in Deutschland |
Bei Verstößen müssen die betroffenen Unternehmen mit Kontrollen und Bußgeldern durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) rechnen. Kleine und mittelständische Unternehmen sowie ausländische Zulieferer sind vom Gesetz ausgenommen.
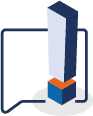
Wichtig:
Auch ausländische Unternehmen mit Zweigniederlassung in Deutschland sind betroffen, wenn die Mitarbeiterschwelle erreicht wird.
Wozu sind Unternehmen verpflichtet?
Unternehmen, die unter das Lieferkettengesetz fallen, müssen eine Reihe gesetzlich definierter Pflichten erfüllen, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße in ihrer Lieferkette zu verhindern. Die Anforderungen variieren je nach Lieferkettenstufe und können sowohl den eigenen Unternehmensbereich als auch die direkten und indirekten Zulieferer betreffen. Die wichtigsten Pflichten des Lieferkettengesetzes im Überblick:
1. Risikomanagement und Risikoanalyse
Unternehmen sind verpflichtet, regelmäßig zu überprüfen, wo in ihrer Lieferkette Risiken für Menschenrechte oder umweltbezogene Standards auftreten können. Diese Risikoanalyse umfasst sowohl den eigenen Geschäftsbereich als auch die direkten Zulieferer – und bei konkreten Anhaltspunkten auch indirekte Lieferanten. Ziel ist es, Gefahren wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung oder Umweltschäden frühzeitig zu erkennen.
2. Grundsatzerklärung
Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten müssen Unternehmen eine öffentlich zugängliche Grundsatzerklärung abgeben. Darin legen sie offen, welche menschenrechtlichen und umweltbezogenen Erwartungen sie an ihre Lieferketten stellen und welche Maßnahmen zur Risikominimierung getroffen werden.
3. Präventionsmaßnahmen
Wenn potenzielle Risiken festgestellt werden, müssen Unternehmen geeignete Maßnahmen zur Vorbeugung ergreifen – sowohl im eigenen Betrieb als auch gegenüber Geschäftspartnern. Dazu zählen unter anderem Schulungen für Mitarbeitende, Anpassungen von Einkaufsprozessen, Lieferantenverträge mit Verhaltenskodizes oder klare Anforderungen in der Auswahl neuer Zulieferer.
4. Abhilfemaßnahmen
Kommt es trotz aller Prävention zu einem konkreten Verstoß gegen Menschenrechte oder Umweltpflichten, sind Unternehmen verpflichtet, unverzüglich Abhilfemaßnahmen einzuleiten. Ziel ist es, die Verletzung zu beenden oder ihr Ausmaß zu minimieren. Das kann auch bedeuten, einzelne Geschäftsbeziehungen zu beenden, wenn keine andere Lösung möglich ist.
5. Beschwerdeverfahren
Das Gesetz schreibt vor, dass ein Beschwerdeverfahren vorhanden sein muss, über welches Hinweise auf mögliche Risiken und Verstöße entlang der Lieferkette gemeldet werden können. Dieses Verfahren muss transparent, zugänglich und fair sein – etwa in Form eines Online-Tools, einer Ombudsstelle oder eines internen Hinweisgebersystems (Whistleblower-System).
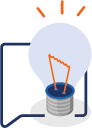
Tipp:
Seit kurzem können auch über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (kurz BAFA) anonym Beschwerden eingereicht werden. Hier geht’s zum Online-Formular für die Einreichung von Beschwerden.
6. Dokumentation
Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Einhaltung der Sorgfaltspflichten müssen laufend dokumentiert werden. Dies umfasst Risikoanalysen, Maßnahmenpläne, Schulungsinhalte, Kommunikation mit Lieferanten sowie die Bearbeitung von Beschwerden. Die Dokumentation dient der Nachvollziehbarkeit und ist Grundlage für die behördliche Prüfung.
7. Berichtspflicht
Einmal jährlich müssen Unternehmen einen Bericht über die Umsetzung ihrer Sorgfaltspflichten erstellen und auf ihrer Website veröffentlichen. Der Bericht muss unter anderem darlegen, welche Risiken identifiziert, welche Maßnahmen ergriffen und welche Ergebnisse erzielt wurden. Er ist beim BAFA einzureichen und unterliegt einer inhaltlichen Prüfung.
Wer kontrolliert die Einhaltung des Gesetzes?
Die Umsetzung und Einhaltung des Lieferkettengesetz wird von dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle überwacht.
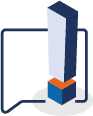
Wichtig für Unternehmen:
Das BAFA bietet auch Leitfäden, FAQs und ein elektronisches Meldeportal für Unternehmen, um ihre Pflichten leichter umzusetzen. Es lohnt sich also, regelmäßig die BAFA-Website zu prüfen.
Bei Verstößen drohen Bußgelder in Höhe von bis zu mehreren Millionen Euro – abhängig von Umsatz des Unternehmens und Schwere des Verstoßes. Aber auch der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen ist möglich. Betroffene können sowohl vor deutschen Gerichten als auch direkt beim BAFA Beschwerde einreichen – Gewerkschaften und NGOs bieten bei der Rechtsvertretung Unterstützung an.
Welche Erweiterungen bringt die neue EU-Richtlinie?
Im Mai 2024 wurde vom EU-Parlament eine weitere Richtlinie verabschiedet, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), die umgangssprachlich auch als EU-Lieferkettengesetz bezeichnet wird. Diese neue EU-Richtlinie verpflichtet Unternehmen in Europa dazu, Menschenrechte und Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten systematisch zu beachten und zu dokumentieren. Sie muss bis Juli 2027 von allen Mitgliedstaaten – also auch Deutschland – in nationales Recht umgesetzt werden.
Die EU-Lieferkettengesetzgebung (CS3D) baut auf dem deutschen Rahmen auf und bringt folgende Erweiterungen:
- Umfassendere Lieferkette: Neben direkten Zulieferern müssen auch mittelbare und nachgelagerte Kettenglieder proaktiv kontrolliert werden
- Schwellenwerte: Gilt für Unternehmen mit ≥1.000 Mitarbeitenden und ≥450 Mio. € Jahresumsatz in der EU
- Zivilrechtliche Haftung: Betroffene (z. B. NGOs, Gewerkschaften) können künftig Schadensersatz geltend machen – in vielen Fällen sogar über fünf Jahre nach einem Verstoß
Fazit
Das Lieferkettengesetz stellt einen wichtigen Schritt hin zu verantwortungsbewusstem Wirtschaften dar. Unternehmen müssen klare Pflichten übernehmen – von der Risikoanalyse bis zum Berichtswesen. Außerdem rückt ab 2027 mit dem EU-Lieferkettengesetz (CS3D) ein noch strengerer Rahmen in den Fokus.
Aufwand & Chancen
Die Einhaltung des Gesetzes ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden, vor allem bei einer großen Anzahl von Zulieferern. Neben den Pflichten bringt das Gesetz aber auch einige Chancen mit sich. Durch die Verpflichtung der Abnehmer, ihre Einkaufspraktiken risikoärmer zu gestalten, können Zulieferer bessere Konditionen aushandeln (wie z.B. faire Preise oder realistische Lieferzeiten), sofern diese zur Verbesserung der Umwelt- und Sozialstandards beitragen. Eine fortlaufende Dokumentation von Risiken und Maßnahmen zur Nachhaltigkeit hilft Zulieferern, Schwachstellen in ihrer Lieferkette zu erkennen und eine Resilienz aufzubauen.
Außerdem fördert ein intensiverer Austausch mit den Abnehmern das Vertrauen und stärkt die Kundenbindung. Optimierte Prozesse im Bereich Menschenrechte und Umweltschutz steigern zudem die Wettbewerbsfähigkeit und sorgen dafür, dass Unternehmen zukunftssicher aufgestellt sind. Darüber hinaus kann das Gesetz Effizienzgewinne fördern, etwa durch Einsparungen im Wasser- und Chemikalienmanagement oder durch gesündere, produktivere Mitarbeitende.
Handlungsempfehlung
Etablieren Sie frühzeitig strukturierte Sorgfaltsprozesse, binden Sie Ihre Compliance-Abteilung eng ein und ziehen Sie bei Bedarf externe Unterstützung hinzu. So schaffen Sie die Grundlage für mehr Transparenz, Rechtssicherheit und Widerstandsfähigkeit – und positionieren Ihr Unternehmen nachhaltig im internationalen Wettbewerb.




